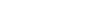PSG Praxis für
seelische Gesundheit Fragen und Antworten
Häufig wird diese Diskussion nicht ganz ideologiefrei geführt. Manche Patienten haben Angst vor der Einnahme von Psychopharmaka, andere wiederum schwören auf den hilfreichen Effekt solcher Medikamente. Unter Wissenschaftlern allerdings besteht mittlerweile weitgehend Einigkeit darüber, dass für etliche psychische Erkrankungen gilt: Die Kombination Psychotherapie und Medikation wirken besser als eines davon alleine. In der Zusammenarbeit von Psychotherapeut und Psychiater liegt folglich eine große Chance.
Nicht alle Erkrankungen erfordern allerdings eine Medikation. Für viele Störungsbilder existieren auch noch keine geeigneten Medikamente. Manchmal können Medikamente sogar hinderlich für den Erfolg einer Psychotherapie sein. Dies ist beispielsweise bei der Angsterkrankung der Fall - insbesondere bei dem Einsatz der so genannten Benzodiazepine.
Im Bereich von Psychosen hingegen besteht kein Zweifel daran, dass Medikamente (Antipsychotika / Neuroleptika) besser wirken als die Psychotherapie, wenngleich diese vor allem für die Rückfallprophylaxe von hoher Wichtigkeit ist.
Wenn der Arzt aufgrund der beschriebenen und wahrnehmbaren Symptome eine depressive Störung eindeutig diagnostiziert, sollte kein Weg an der medikamentösen Therapie mit einem Antidepressivum vorbei gehen. Die Antidepressiva wirken gezielt auf die Gehirnstoffwechselstörung. Je früher man in einer Krankheitsphase mit der Einnahme eines Antidepressivums beginnt, desto leichter und schneller überwindet der Kranke die Depression, desto schneller steht er wieder voll im Leben.
Bis auf die Gruppe der Benzodiazepine / Anxiolytika verursachen Psychopharmaka keine Abhängigkeiten. Die meisten ihrer Nebenwirkungen sind reversibel, d.h. wenn das Medikament abgesetzt wird, verschwinden auch mögliche Nebenwirkungen wieder vollständig.
Psychotherapie kann (in seltenen Fällen) ebenfalls unerwünschte Nebenwirkungen haben. Diese Gefährdung besteht vor allem bei intensiver emotionaler Aktivierung und einem hohen Machtgefälle zwischen Therapeut und Patient, verbunden mit dessen psychischer Entmündigung. Hilfreich zur Vermeidung dieser Nebenwirkungen sind: Transparenz des therapeutischen Vorgehens, Autonomie und unbedingte Freiwilligkeit seitens des Patienten, "menschliche Greifbarkeit" des Therapeuten (kein unpersönliches Schweben über den Dingen) und ein Fokus auf der Bewältigung der gemeinsam festgelegten Problemstellungen. Dies ist bei der modernen kognitiven Verhaltenstherapie, bei der Gesprächspsychotherapie nach Rogers und auch bei anderen modernen psychotherapeutischen Verfahren in der Regel gewährleistet.
Der Streit zwischen Erbe (Vererbung) und Umwelt ist ein alter, welcher bis heute nicht zufriedenstellend gelöst wurde. Mit "zufriedenstellend" meine ich dabei die Möglichkeit einer einfachen Aussage wie z.B. "Bei Person X liegt Ihre psychische Erkrankung Y zu 40% an Ihren Genen und zu 60% an Ihrer schlechten Kindheit".
Eine solche Aussage wird sich nie treffen lassen, denn das Wechselspiel von Erbe und Umwelt ist viel komplexer als wir bisher ahnen. Neueste Forschungsergebnisse legen sogar nahe, dass die Erlebnisse eines Menschens tatsächlich sein Erbgut verändern können, welches er dann wieder an seine Kinder weitergibt - etwas, was bisher undenkbar schien. Zwillingsstudien haben nachgewiesen, dass es für fast alle psychischen Erkrankungen wie z.B. Angststörungen, Depressionen und Schizophrenie genetische Ursachen gibt.
Ist unser Schicksal also genetisch vorgezeichnet? Dem ist ganz sicher nicht so: In gängigen Zwillingsstudien war es bei eineiigen Zwillingen (und weitgehend identischer Erziehung) meist nicht einmal bei 50% der Zwillinge der Fall, dass beide die gleiche psychische Erkrankung aufwiesen oder ähnliche Lebensentscheidungen trafen. Weiter gilt die Erkrankung der Schizophrenie als hoch genetisch bestimmt, dennoch erkranken etwa 80% der schizophrenen Patienten an dieser Erkrankung, ohne dass es einen Vorfahren mit dieser Erkrankung in Ihrer Verwandtschaft gegeben hätte.
Es muss also eine Menge weiterer Faktoren geben. Neben biologischen Schädigungen (z.B. durch negative Einflüsse auf die Entwicklung eines Kindes während der Schwangerschaft) deutet dies auf die ebenfalls hohe Bedeutung der Umweltfaktoren hin: Die Prägung in der Kindheit, traumatische Erlebnisse, aber auch aktueller Alltagsstress tragen nachweislich zu psychischen Erkrankungen bei.
Es ergibt sich folglich ein multikausales Modell (ein Modell mit vielen Ursachen): Gene, biologische Schäden und frühe Kindheitserfahrungen können eine Verwundbarkeit oder Anfälligkeit für eine spezifische psychische Erkrankung bilden. Ob diese allerdings ausbricht, liegt vor allem an der Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit. Überfordernder Alltagsstress, ungünstiger Umgang mit Herausforderungen, ungünstige Lebensentscheidungen und -überzeugungen (hier kommt der freie Wille ins Spiel) und aktuelle emotionale Belastungen bilden häufig den unspezifischen Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt: Die Krankheit bricht aus. Dieses Modell nennt sich Vulnerabilitäts-Stress-Modell oder Dispositions-Stress-Modell (was Verwundbarkeits-Stress-Modell bzw. Veranlagungs-Stress-Modell bedeutet). Diese Verwundbarkeit bedeutet jedoch keinesfalls, dass die Krankheit ausbrechen muss: Ein vererbter "schlechter Rücken" führt nicht zwangsläufig zu einem Bandscheibenvorfall - es kommt darauf an, wie sich die Belastungen gestalten.
In der modernen Psychotherapie geht es nun zunächst um eine individuelle Analyse, um herauszufinden, welche Belastungen eine Krankheit ausgelöst haben und welche Belastungen diese aufrechterhalten. Weiter werden Strategien eingeübt, wie diese Belastungen besser abgepuffert oder vermieden werden können - auch mit Hilfe der Ressourcen (Stärken) einer Person.
Allerdings lässt sich auch die Verwundbarkeit selbst abmildern, z.B. durch gesundheitsförderliches Verhalten ("Krankengymnastik" im psychischen Bereich - um beim Beispiel des Rückens zu bleiben). Manchmal kann hierbei auch eine prophylaktische Medikation helfen.
Im Allgemeinen werden diese Berufsbezeichnungen durcheinander geworfen und auch in der Presse oft wie Synonyme eingesetzt.
Diplom-Psychologen absolvieren für diesen Titel ein Studium der Psychologie, verbunden mit einem Staatsexamen und der Approbation, und nennen sich dann "Psychologischer Psychotherapeut".
Die Ausbildung von Ärzten zum Psychotherapeuten ist je nach Facharztgruppe recht unterschiedlich. Nach dem Medizinstudium geschieht dies meist im Rahmen der fachärztlichen Ausbildung im Fachbereich Psychiatrie. Solcherart ausgebildete Ärzte nennen sich dann „Ärztlicher Psychotherapeut".
"Psychiater" hingegen ist die Bezeichnung für einen Arzt, welcher nach seinem üblichen Medizin-Studium eine Fachweiterbildung in Psychiatrie gemacht hat, welche ihn befähigt, psychische Krankheiten mit Medikamenten (Psychopharmaka) zu behandeln. Ein Psychiater trägt einen Facharzttitel, in welchem das Wort "Psychiatrie" vorkommt. Auch die Bezeichnung "Nervenarzt" meint einen Psychiater.
Eine gute und umfangreiche Ausbildung ist für den komplizierten Prozess einer Psychotherapie unabdingbar. Weiter entscheidet aber auch die Persönlichkeit, die praktische Erfahrung und die Lebensweisheit eines Therapeuten über seine Eignung als hilfreicher Begleiter auf dem Weg der Genesung. Deshalb kann selbstverständlich prinzipiell jeder der hier vorgestellten Therapeuten ein guter Therapeut oder Lebensberater sein, unabhängig von seiner fachlichen Mindestqualifikation.
Dieses häufig in Cartoons skizzierte Bild beschreibt lediglich eine einzige Form der vielen Psychotherapie-Arten: Die klassische Psychoanalyse. Sie wird nicht mehr allzu häufig eingesetzt und ist meist mit sehr hohen Stundenzahlen verbunden (oft viele hundert Stunden über viele Jahre).
Solche psychoanalytischen Langzeittherapien konnten sich in Studien nicht als wirksamer erweisen, als kürzere moderne Verfahren wie die moderne Tiefenpsychologie, die Gesprächspsychotherapie oder die kognitive Verhaltenstherapie, welche meist mit weniger als 100 Stunden auskommen (die kognitive Verhaltenstherapie oft sogar mit deutlich weniger als 50 Stunden).
Fragen und Antworten
Häufig wird diese Diskussion nicht ganz ideologiefrei geführt. Manche Patienten haben Angst vor der Einnahme von Psychopharmaka, andere wiederum schwören auf den hilfreichen Effekt solcher Medikamente. Unter Wissenschaftlern allerdings besteht mittlerweile weitgehend Einigkeit darüber, dass für etliche psychische Erkrankungen gilt: Die Kombination Psychotherapie und Medikation wirken besser als eines davon alleine. In der Zusammenarbeit von Psychotherapeut und Psychiater liegt folglich eine große Chance.
Nicht alle Erkrankungen erfordern allerdings eine Medikation. Für viele Störungsbilder existieren auch noch keine geeigneten Medikamente. Manchmal können Medikamente sogar hinderlich für den Erfolg einer Psychotherapie sein. Dies ist beispielsweise bei der Angsterkrankung der Fall - insbesondere bei dem Einsatz der so genannten Benzodiazepine.
Im Bereich von Psychosen hingegen besteht kein Zweifel daran, dass Medikamente (Antipsychotika / Neuroleptika) besser wirken als die Psychotherapie, wenngleich diese vor allem für die Rückfallprophylaxe von hoher Wichtigkeit ist.
Wenn der Arzt aufgrund der beschriebenen und wahrnehmbaren Symptome eine depressive Störung eindeutig diagnostiziert, sollte kein Weg an der medikamentösen Therapie mit einem Antidepressivum vorbei gehen. Die Antidepressiva wirken gezielt auf die Gehirnstoffwechselstörung. Je früher man in einer Krankheitsphase mit der Einnahme eines Antidepressivums beginnt, desto leichter und schneller überwindet der Kranke die Depression, desto schneller steht er wieder voll im Leben.
Bis auf die Gruppe der Benzodiazepine / Anxiolytika verursachen Psychopharmaka keine Abhängigkeiten. Die meisten ihrer Nebenwirkungen sind reversibel, d.h. wenn das Medikament abgesetzt wird, verschwinden auch mögliche Nebenwirkungen wieder vollständig.
Psychotherapie kann (in seltenen Fällen) ebenfalls unerwünschte Nebenwirkungen haben. Diese Gefährdung besteht vor allem bei intensiver emotionaler Aktivierung und einem hohen Machtgefälle zwischen Therapeut und Patient, verbunden mit dessen psychischer Entmündigung. Hilfreich zur Vermeidung dieser Nebenwirkungen sind: Transparenz des therapeutischen Vorgehens, Autonomie und unbedingte Freiwilligkeit seitens des Patienten, "menschliche Greifbarkeit" des Therapeuten (kein unpersönliches Schweben über den Dingen) und ein Fokus auf der Bewältigung der gemeinsam festgelegten Problemstellungen. Dies ist bei der modernen kognitiven Verhaltenstherapie, bei der Gesprächspsychotherapie nach Rogers und auch bei anderen modernen psychotherapeutischen Verfahren in der Regel gewährleistet.
Der Streit zwischen Erbe (Vererbung) und Umwelt ist ein alter, welcher bis heute nicht zufriedenstellend gelöst wurde. Mit "zufriedenstellend" meine ich dabei die Möglichkeit einer einfachen Aussage wie z.B. "Bei Person X liegt Ihre psychische Erkrankung Y zu 40% an Ihren Genen und zu 60% an Ihrer schlechten Kindheit".
Eine solche Aussage wird sich nie treffen lassen, denn das Wechselspiel von Erbe und Umwelt ist viel komplexer als wir bisher ahnen. Neueste Forschungsergebnisse legen sogar nahe, dass die Erlebnisse eines Menschens tatsächlich sein Erbgut verändern können, welches er dann wieder an seine Kinder weitergibt - etwas, was bisher undenkbar schien. Zwillingsstudien haben nachgewiesen, dass es für fast alle psychischen Erkrankungen wie z.B. Angststörungen, Depressionen und Schizophrenie genetische Ursachen gibt.
Ist unser Schicksal also genetisch vorgezeichnet? Dem ist ganz sicher nicht so: In gängigen Zwillingsstudien war es bei eineiigen Zwillingen (und weitgehend identischer Erziehung) meist nicht einmal bei 50% der Zwillinge der Fall, dass beide die gleiche psychische Erkrankung aufwiesen oder ähnliche Lebensentscheidungen trafen. Weiter gilt die Erkrankung der Schizophrenie als hoch genetisch bestimmt, dennoch erkranken etwa 80% der schizophrenen Patienten an dieser Erkrankung, ohne dass es einen Vorfahren mit dieser Erkrankung in Ihrer Verwandtschaft gegeben hätte.
Es muss also eine Menge weiterer Faktoren geben. Neben biologischen Schädigungen (z.B. durch negative Einflüsse auf die Entwicklung eines Kindes während der Schwangerschaft) deutet dies auf die ebenfalls hohe Bedeutung der Umweltfaktoren hin: Die Prägung in der Kindheit, traumatische Erlebnisse, aber auch aktueller Alltagsstress tragen nachweislich zu psychischen Erkrankungen bei.
Es ergibt sich folglich ein multikausales Modell (ein Modell mit vielen Ursachen): Gene, biologische Schäden und frühe Kindheitserfahrungen können eine Verwundbarkeit oder Anfälligkeit für eine spezifische psychische Erkrankung bilden. Ob diese allerdings ausbricht, liegt vor allem an der Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit. Überfordernder Alltagsstress, ungünstiger Umgang mit Herausforderungen, ungünstige Lebensentscheidungen und -überzeugungen (hier kommt der freie Wille ins Spiel) und aktuelle emotionale Belastungen bilden häufig den unspezifischen Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt: Die Krankheit bricht aus. Dieses Modell nennt sich Vulnerabilitäts-Stress-Modell oder Dispositions-Stress-Modell (was Verwundbarkeits-Stress-Modell bzw. Veranlagungs-Stress-Modell bedeutet). Diese Verwundbarkeit bedeutet jedoch keinesfalls, dass die Krankheit ausbrechen muss: Ein vererbter "schlechter Rücken" führt nicht zwangsläufig zu einem Bandscheibenvorfall - es kommt darauf an, wie sich die Belastungen gestalten.
In der modernen Psychotherapie geht es nun zunächst um eine individuelle Analyse, um herauszufinden, welche Belastungen eine Krankheit ausgelöst haben und welche Belastungen diese aufrechterhalten. Weiter werden Strategien eingeübt, wie diese Belastungen besser abgepuffert oder vermieden werden können - auch mit Hilfe der Ressourcen (Stärken) einer Person.
Allerdings lässt sich auch die Verwundbarkeit selbst abmildern, z.B. durch gesundheitsförderliches Verhalten ("Krankengymnastik" im psychischen Bereich - um beim Beispiel des Rückens zu bleiben). Manchmal kann hierbei auch eine prophylaktische Medikation helfen.
Im Allgemeinen werden diese Berufsbezeichnungen durcheinander geworfen und auch in der Presse oft wie Synonyme eingesetzt.
Diplom-Psychologen absolvieren für diesen Titel ein Studium der Psychologie, verbunden mit einem Staatsexamen und der Approbation, und nennen sich dann "Psychologischer Psychotherapeut".
Die Ausbildung von Ärzten zum Psychotherapeuten ist je nach Facharztgruppe recht unterschiedlich. Nach dem Medizinstudium geschieht dies meist im Rahmen der fachärztlichen Ausbildung im Fachbereich Psychiatrie. Solcherart ausgebildete Ärzte nennen sich dann „Ärztlicher Psychotherapeut".
"Psychiater" hingegen ist die Bezeichnung für einen Arzt, welcher nach seinem üblichen Medizin-Studium eine Fachweiterbildung in Psychiatrie gemacht hat, welche ihn befähigt, psychische Krankheiten mit Medikamenten (Psychopharmaka) zu behandeln. Ein Psychiater trägt einen Facharzttitel, in welchem das Wort "Psychiatrie" vorkommt. Auch die Bezeichnung "Nervenarzt" meint einen Psychiater.
Eine gute und umfangreiche Ausbildung ist für den komplizierten Prozess einer Psychotherapie unabdingbar. Weiter entscheidet aber auch die Persönlichkeit, die praktische Erfahrung und die Lebensweisheit eines Therapeuten über seine Eignung als hilfreicher Begleiter auf dem Weg der Genesung. Deshalb kann selbstverständlich prinzipiell jeder der hier vorgestellten Therapeuten ein guter Therapeut oder Lebensberater sein, unabhängig von seiner fachlichen Mindestqualifikation.
Dieses häufig in Cartoons skizzierte Bild beschreibt lediglich eine einzige Form der vielen Psychotherapie-Arten: Die klassische Psychoanalyse. Sie wird nicht mehr allzu häufig eingesetzt und ist meist mit sehr hohen Stundenzahlen verbunden (oft viele hundert Stunden über viele Jahre).
Solche psychoanalytischen Langzeittherapien konnten sich in Studien nicht als wirksamer erweisen, als kürzere moderne Verfahren wie die moderne Tiefenpsychologie, die Gesprächspsychotherapie oder die kognitive Verhaltenstherapie, welche meist mit weniger als 100 Stunden auskommen (die kognitive Verhaltenstherapie oft sogar mit deutlich weniger als 50 Stunden).